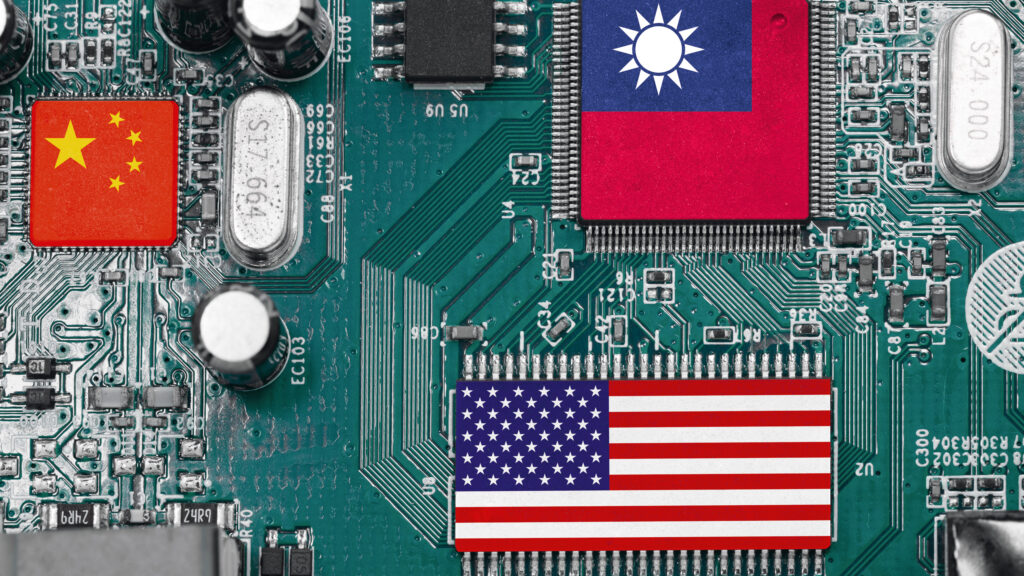Im Hinblick auf das Spannungsfeld zwischen dem notwendigen Erreichen von Nachhaltigkeitszielen auf der einen Seite und dem fast unvermeidlichen Erscheinen des Kartellrechts auf der anderen Seite, wenn es um das Zusammenwirken mit Wettbewerbern zur Verwirklichung innovativer Ansätze geht, die letztlich ja einer Verbesserung der Umweltbilanz dienen, lagen viele Hoffnungen auf den lange angekündigten Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission. Ziele waren hier, Orientierung zu schaffen und für Klarheit zu sorgen. Und die gewünschten und benötigten Rahmenbedingungen zu realisieren, in denen Unternehmen es gelingt, den Spagat zwischen grüner Innovation durch Investition und für sie zukunftsfähigen Geschäftsmodellen zu bewerkstelligen. Letztlich sollte es also genau darum gehen, die Sorgen und Bedürfnisse von Rechtsabteilungen zu adressieren. Im letzten Sommer war es dann so weit, die EU-Kommission veröffentlichte die neuen Leitlinien. „Sie sind ein gut gemeinter Versuch, die kartellrechtlichen Zügel so weit zu lockern, dass sie einem wirksamen Umweltschutz nicht im Wege stehen, das ist grundsätzlich zu begrüßen“, sagt Dr. Bertold Bär-Bouyssière, Partner bei der Sozietät Dentons. Die EU-Kommission hätte in ihren Leitlinien Nachhaltigkeitskooperationen generell vom Kartellverbot in Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ausnehmen können. Das hat sie nicht getan, sie nennt in einem ersten Schritt Beispiele, in denen Wettbewerbsbeschränkungen „unwahrscheinlich“ sind. „Diese Formulierung wählt die Kommission regelmäßig, in der Praxis wird man ‚unwahrscheinlich‘ grundsätzlich wie ein ‚ausgeschlossen‘ verstehen“, konkretisiert Dr. Jonas Brueckner, Partner bei KPMG Law. Angesprochen sind hier Fälle, bei denen im Grunde klar ist, dass sie schwerlich einem kartellrechtlichen Vorwurf begegnen werden. Unternehmen, Lieferanten und Händler müssen Anforderungen oder Verbote aus internationalen Verträgen, Vereinbarungen oder Übereinkommen einhalten. Es geht um Vereinbarungen, die das unternehmensinterne Verhalten betreffen oder branchenweite Sensibilisierungs- oder Kundenkampagnen zu Umweltauswirkungen organisieren. Und es sind Vereinbarungen genannt zur Einrichtung von Datenbanken mit allgemeinen Informationen über Lieferanten, Wertschöpfungsketten, Produktionsprozessen oder Händler, „solange es nicht darum geht, Parteien zu verbieten, bei bestimmten Lieferanten einzukaufen oder an bestimmte Händler zu verkaufen“, ergänzt Brueckner. Diese Beispiele indes liefern direkt eine Angriffsfläche und zeigen eine große Crux der Leitlinien. Dr. Sascha Reichardt, Vice President – Division General Counsel and Division Compliance Officer Agricultural Solutions der BASF SE, bringt das auf den Punkt: „Die Kommission geht mit den Leitlinien nicht über das hinaus, was selbstverständlich gilt. Sie bietet keinen nennenswerten Mehrwert für den Umgang mit Nachhaltigkeitsvereinbarungen.“ Die Leitlinien bleiben just an den Punkten unklar, wo sie hätten für Klarheit sorgen können oder Unternehmen mehr Spielraum gewähren, um die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zu ermöglichen.

„Eigentlich sollte die Europäische Kommission bestrebt sein, Initiativen im Sinne der Nachhaltigkeit stärker zu fördern, auch aus kartellrechtlicher Sicht – indem sie mehr Anreize für die Zusammenarbeit bietet.“
Dr. Sascha Reichardt
Division General Counsel Agricultural Solutions,
BASF SE
Unternehmen brauchen Kooperationen
Ein Beispiel: „Die Kommission führt aus, dass Nachhaltigkeitsvereinbarungen, die eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 bezwecken oder bewirken, dennoch unter die Ausnahmeregelung nach Artikel 101 Absatz 3 fallen können, wenn die Parteien nachweisen können, dass die vier kumulativen Voraussetzungen dieser Bestimmung erfüllt sind. Damit wendet sie die exakt gleichen Maßstäbe an wie auf alle Vereinbarungen – ohne den eigentlich zu fördernden Aspekt der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Ohne Kooperationen wird es schwierig werden, Innovationen zu erzielen. „Die Transformation in der Automobilindustrie erfordert Kooperationen in gesteigertem Maß“, bestätigt Sebastian Windolf, Director Legal bei der ZF Group. „Das trifft grundsätzlich auch im Bereich Nachhaltigkeit zu.“ Seines Erachtens umfasst dabei die Verwirklichung von Nachhaltigkeitszielen in einem kartellrechtskonformen Ansatz zwingend notwendige Standardisierungsbemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Kooperationen auch zwischen Wettbewerbern werden notwendig sein, nicht nur, um selbst formulierte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern letztlich um den entscheidenden Turnaround im Hinblick auf den Klimawandel zu schaffen. Nur wenige Unternehmen wollen auf sich gestellt erst einmal viel Geld in neue Anlagen stecken – oder sind überhaupt in der Lage dazu. „Viele Unternehmen sind – so, mein Eindruck –, darauf bedacht, wirklich einen Unterschied zu machen und nachhaltiger zu agieren“, sagt Reichardt. Dazu sind jedoch Investitionen erforderlich, die viele vor finanzielle Schwierigkeiten stellen. „Wenn ich mich nicht mit anderen zusammentun kann, die auf dem Gebiet Expertise haben und Innovationen gemeinsam vorantreiben kann, dann wird das Ziel, dass Nachhaltigkeit eine große Anzahl von Betrieben erreicht, verfehlt. Dann bleibt es bei wenigen und meist großen Unternehmen, die das finanziell stemmen und noch profitabel arbeiten können“, sagt er und schlägt in dem Zusammenhang eine Abkehr von der bisherigen Vorgehensweise der EU-Kommission vor. „Weg von der ausnahmsweisen Duldung einer Nachhaltigkeitskooperation – stets mit dem Risiko eines kartellrechtlichen Verbots verbunden –, sollte sie hin zu dem Bekenntnis kommen, dass Zusammenarbeit zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen generell gewünscht ist. Unerwünschtes lässt sich mit dem Ziehen klarer Grenzlinien vermeiden.“ Gemeint sind damit die klassischen Anwendungsfälle des Kartellverbots, sprich bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen und der Austausch von hochsensiblen Wettbewerbsinformationen wie Preise und Kundenbeziehungen bleiben grundsätzlich verboten.
Die angemessene Verbraucherbeteiligung
„Die Leitlinien basieren auf einem methodologischen Ansatz, der den Umweltschutz in die zweite Reihe zurückdrängt“, moniert Dr. Bertold Bär-Bouyssière. Zum ersten sei zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen den Wettbewerb beschränkt. Ist das der Fall, weil etwa die Preise infolge der Kooperation ansteigen, stellt sich die Frage, ob Klimagesichtspunkte diese Wettbewerbsbeschränkungen unter dem Gesichtspunkt von Effizienzen rechtfertigen können. „Wir sind hier bei der altbekannten Prüfung des Artikel 101 Abs.3 AEUV, die schon immer etwas von Pi mal Daumen hatte. Zu wünschen ist, dass die Prüfung bei Umweltschutzeffizienzen nicht strenger ausfällt als bisher. Solange die Kollaboration nicht das Geschmäckle von Greenwashing hat, sollte der Grundsatz ‚im Zweifel für die Umwelt‘ gelten.“ Vom Kartellverbot sind Ausnahmen zulässig und Wettbewerbsbeschränkungen sind erlaubt – wenn sie unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen. „Dies wird bis heute von der Europäischen Kommission überwiegend so verstanden, dass es eine Effizienzsteigerung im Sinne eines günstigeren Preises gibt“, erklärt Dr. Maxim Kleine, Partner und Leiter Kartellrecht bei der Sozietät Görg. „Das ist auch bei uns in Deutschland seit Jahrzehnten gedanklich fest verankert.“ Für Dr. Dominika Wojewska, Associate bei Dentons, ist die Verbraucherbeteiligung die „konzeptionell schwierigste Hürde“. Vergleichsweise einfach darzustellen sei das, wenn der Käufer des teureren Produkts unmittelbar vom Preisanstieg profitiert, weil die objektive Qualität des Produktes erhöht wird. Das sei etwa beim Kauf von für die Verbraucher gesünderen Biohühnern der Fall. „Oder wenn das an der Zahlungsbereitschaft zu messende subjektive Käuferempfinden erhöht ist, wie das zum Beispiel beim Fair-Trade-Kaffee der Fall ist.“ Mehrzahler und Begünstigte fänden sich hier im gleichen relevanten Markt zusammen. „Schwieriger ist es bei Abreden, deren Umwelteffizienzen der weiteren Gesellschaft zugutekommen, das sind sogenannte kollektive Vorteile“, sagt Wojewska. Da soll eine erhebliche Überschneidung von Zahlern und Begünstigten erforderlich sein. Das kann in der Praxis schwierig sein, Bär-Bouyssière und Wojewska schildern ein an den Leitlinien der Kommission angelehntes fiktives Beispiel, in dem die Taxiunternehmen in München gemeinschaftlich beschließen, künftig teureren Biokraftstoff zu nutzen. „Da käme es darauf an: ist die Mehrheit der Taxikunden aus München oder sind es überwiegend Externe? Und ist die Einführung von Biokraftstoff nicht generell eine gute Sache?“ Noch schwieriger sei es, wenn Vorteile ganz woanders entstehen und etwa Textilhersteller beschließen, Giftstoffe aus der Produktion zu bannen – die höheren Kosten entstehen dann bei den Kunden in Europa, es profitieren in erster Linie aber die an der Produktion Beteiligten im Entwicklungsland. Hier würde die Kommission keine wesentlichen Überschneidungen erkennen und eine Wettbewerbsbeschränkung nicht für gerechtfertigt halten „Die Kommission räumt ein, hier nicht genug Erfahrung zu haben und verspricht Nachlieferungen. Diese lassen aber erfahrungsgemäß länger auf sich warten als beim ‘Habersack’“, bemängelt Bär-Boussière.

„Bei den kollektiven Vorteilen soll eine erhebliche Überschneidung von Zahlern und Begünstigten erforderlich sein. Das zu ermitteln kann in der Praxis schwierig sein.“
Dr. Dominika Wojewska
Associate,
Dentons
Marktanteil als große Crux
Dr. Maxim Kleine von Görg fordert ein radikales volkswirtschaftliches Umdenken. Nirgendwo im GWB oder im Artikel 101 AEUV stehe, dass ein Effizienzvorteil immer ein günstigerer Preis sein muss, das kann genauso gut die Reduktion von CO2-Emissionen sein – „und die kommt selbstverständlich dem Verbraucher zugute“, betont er. „Das Umdenken, was hier erforderlich ist, das hat weder in der Politik stattgefunden noch auf Behördenseite, geschweige denn bei den Richterinnen und Richtern. Und das macht es so komplex.“ Das bedeutet, das Klammern der Politik und Gesetzgebung am Preisdogma muss aus den Köpfen und ersetzt werden: Die CO2-Emissionsreduktion – und zwar weltweit – muss als wichtiger Wohlfahrtsvorteil verstanden werden – „dafür braucht es nicht einmal eine Gesetzesänderung“, so Kleine. Und es muss endlich jemand den Mut aufbringen, deutlich zu sagen, dass die Erreichung der angestrebten Nachhaltigkeitsziele ohne Preissteigerungen schlicht unmöglich ist. Selbstverständlich wird sich etwa der Preis von Stahl vervielfachen, wenn sich die Produzenten auf die Erzeugung von grünem Stahl einigen. Da ist sich Kleine sicher: „EU-Kommission und Kartellbehörden würden hier sofort einschreiten. Wenn ich als Rechtsanwalt vor Gericht argumentiere, wir haben Effizienzvorteile und fünf Jahre früher als geplant grünen Stahl, sparen X-1000 Tonnen CO2 und schaffen es, uns dem 1,5-Grad-Ziel anzunähern, ist es aktuell in höchstem Grade unsicher, dass ich damit durchkomme. Und genau da liegt ein Riesenproblem, es müsste jedem einleuchten, dass davon alle profitieren.“ Quasi den endgültigen Knock-Out versetzt den gemeinsamen Vorhaben zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen die Festlegung, dass der Marktanteil der kooperierenden Unternehmen 20 Prozent nicht übersteigen darf, auch wenn sich der Schwellenwert, wie KPMG-Partner Brueckner bemerkt, „auf dem Niveau bewegt, das die Kommission auch in anderen Bereichen der horizontalen Zusammenarbeit zugrunde legt, etwa bei den Gruppenfreistellungen für Spezialisierung oder Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen.“ Er sagt, dass für effektive Nachhaltigkeitsnormenvereinbarungen „der Maßstab ein anderer sein müsste – „eine Größenordnung von 40 Prozent und mehr würde einen Impuls setzen und effektiver wirken.“ Maxim Kleine wird noch deutlicher: „Mit 20 Prozent schaffen wir die Dekarbonisierung ganz sicher nicht, wir brauchen mindestens 60 Prozent. Im Übrigen kann jeder Volkswirt berechnen, welchen kommerziellen Schaden CO2 verursacht und wie hoch der volkswirtschaftliche Vorteil der Reduktion von CO2 ist.“ Es ist nicht so, dass es zu den aktuellen Ausführungen der EU-Kommission keine Alternativen gäbe.

„Wir müssen dringend neue Zielsetzungen verfolgen, und das hat ausschließlich etwas mit dem Herunterbrechen des von der Kommission beschworenen ‚New Green Deal‘ in die Anwendungspraxis des bestehenden Rechts
zu tun.“
Dr. Maxim Kleine
Partner und Leiter Kartellrecht,
Görg
Vieles bleibt auf der Strecke
Für das konkret aufgeworfene Problem schlägt er vor, dass bei Übersteigen eines Marktanteils von 60 Prozent „die beteiligten Unternehmen mittels einer qualifizierten volkswirtschaftlichen Studie nachweisen müssen, dass etwaige Preiserhöhungen nicht mehr als 90 Prozent der generierten CO2-Vorteile betragen.“ Dr. Sascha Reichardt ergänzt, dass der von der EU-Kommission vorgesehene „Soft Safe Harbour“, der Kooperationen unter bestimmten Umständen erlaubt, in vielen Punkten gut klingt, aber beim Marktanteil von 20 Prozent aufhört, sinnvoll zu sein: „Das führt unweigerlich dazu, dass die starken Unternehmen, die auch die Ressourcen haben, etwas gemeinsam zu schaffen, nicht mehr zusammenarbeiten können und deshalb ein Riesenpotenzial verloren geht.“ Und auch wenn die Kommission betone, dass das Nichterfüllen einer Kondition aus dem Soft Safe Harbour nicht bedeute, dass eine Kooperation automatisch verboten ist – „es wird in der Praxis genauso behandelt werden. Denn es führt zu einer Unsicherheit und letztlich dazu, dass die Unternehmen, die nicht besonders mutig voranschreiten und Risiken eingehen, ganz davon ablassen. Die Kommission hätte deutlich mehr machen können, wenn sie wirklich unterstützen will, dass europäische Unternehmen zusammenarbeiten und die Nachhaltigkeit fördern.“ Ein alternativer Vorschlag könnte sein, dass Unternehmen eine Kooperation anmelden und die Kommission diese im Einzelfall freigibt „immer vor dem Hintergrund, dass diese Kooperationen ein tieferes Ziel haben, als es die derzeit vorherrschenden ökonomisch geprägte Interpretation des Artikels 101 Abs. 3 AEUV widerspiegelt.“ Eine weitere Option wäre, dass die EU-Kommission genau hinsieht, was einige Mitgliedstaaten machen: Österreich etwa hat in sein Kartellgesetz geschrieben, dass die konkrete Beteiligung der Verbraucher beim Nachweis ökologischer Vorteile vermutet wird. „Das erleichtert den Nachweis und führt zu einer umfassenderen Berücksichtigung von Effizienzgewinnen außerhalb des Marktes“, sagt Brueckner von KPMG Law. In den Niederlanden gibt es einen Entwurf seitens der Verbraucher- und Marktaufsichtsbehörde ACM, nach der Effizienzen nur objektiver Art sein müssen und der gesamten Gesellschaft sowie zukünftigen Generationen zugute kommen können. Warum solche zielführenden Gedanken keinen Eingang in die Horizontalleitlinien fanden, erschließt sich nicht. Als Alternative bleibt den Unternehmen im Grunde aktuell nur, in den sauren Apfel zu beißen und allein vorzugehen oder Kooperationen mit Nicht-Wettbewerbern einzugehen. Die BASF SE realisiert beispielsweise gemeinsam mit Energieversorgern Windparkprojekte. „Wir brauchen sie als Partner, um die Energiewende für die BASF zu schaffen. Indem wir gemeinsam investieren, können wir unsere Standorte mit grüner Energie versorgen“, sagt Reichardt. So etwas geschieht nicht nur in Europa, sondern „beispielsweise auch in China beabsichtigen wir unseren neuen Verbundstandort mit Strom aus einem offshore Windpark zu versorgen.“ Das sei aber nur ein Schritt – weitere müssten folgen: „Wir müssten Zusammenarbeit fördern, um Effizienzen in Europa gemeinsam zu erreichen und zu nutzen.“ Die Horizontalleitlinien liefern im Ergebnis allenfalls eine grobe Orientierung und fassen Selbstverständliches zusammen. Der notwendige Schritt zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen wird damit nicht gemacht.
■ Alexander Pradka